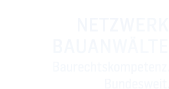Umweltrecht, Klimarecht und Energierecht
Umweltrecht
Der Schutz von Wasser, Boden und Luft als wesentliche natürliche Lebensgrundlagen wird durch zahlreiche Gesetze gewährleistet, die als Umweltrecht zusammengefasst werden können. Diese Regelungen müssen aufgrund des technischen Fortschritts und der zunehmenden Relevanz derartiger Schutzsysteme kontinuierlich verändert und angepasst werden. Als Ihr Anwalt im Umweltrecht sind wir stets über alle Neuerungen informiert.
Der dem Umweltrecht zugrunde liegende Leitgedanke, dass eine nachhaltige Entwicklung nur möglich ist, wenn Wirtschaft und Umweltschutz gleichermaßen Berücksichtigung finden, ergibt sich aus Artikel 11 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Danach müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden.
Damit ist innerhalb der EU normiert, dass Nachhaltigkeit neben einer ökonomischen und einer sozialen immer auch eine ökologische Dimension hat. Dieser „Dreiklang der Nachhaltigkeit“ ergibt sich zum Beispiel auch aus § 1 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) bei der Beschreibung einer nachhaltigen Raumentwicklung. Weitere wichtige Teilbereiche des Umweltrechts sind das Energierecht, das Naturschutzrecht, das Immissionsschutzrecht, das Wasserrecht, das Bodenschutzrecht und das Abfallrecht (Abfallbeseitigung und -verwertung).
Klimarecht
In Sachen Klimarecht ist mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz (Beschluss vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18) die rechtliche Bedeutung des Klimaschutzes sowie der in den vergangenen Jahren – auf europäischer und auf nationaler Ebene – verabschiedeten Gesetze im Rahmen des Klimarechts deutlich gestiegen. Für Unternehmen stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da sie sich nun unter anderem um die CO2-neutrale Umgestaltung ihrer Energiekonzepte zu kümmern haben, um den vielfältigen Anforderungen, die das Klimarecht zu bewältigen hat, auch in Zukunft zu genügen. Die damit verbundenen Rahmenbedingungen müssen auf den Einzelfall übertragen und optimale Lösungsansätze gefunden werden.
Energierecht
Im Mittelpunkt des Energierechts steht die Energiewende, die nicht nur die deutsche Volkswirtschaft vor große Herausforderungen stellt, denn: Energieversorgung ist lebenswichtig. Dies – wie auch die Tatsache, dass die Energieversorgung dauerhaft gesichert sein muss – ist nicht nur seit dem Ukraine-Krieg bekannt. Weniger bekannt ist hingegen die Tatsache, dass der Energiesektor wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor gesetzlich normiert beziehungsweise reguliert ist und damit einer intensiven staatlichen Kontrolle unterliegt. Die Leitlinie des Gesetzgebers hierbei: Nur durch einen staatlich regulierten Rahmen kann die Versorgungssicherheit, sowohl der Bürger als auch der Industrie, gewährleistet werden und andererseits Wettbewerb unter den Energieversorgern stattfinden. Und zunehmend spielt – nicht nur in tatsächlicher und politischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht – der Schutz von Klima und Umwelt im Energierecht eine Rolle.
Das Energierecht gehört zu den komplexesten Rechtsgebieten im deutschen Rechtssystem. Dies ist nicht nur auf die komplizierten technischen Zusammenhänge zurückzuführen, sondern auch darauf, dass sich das Energierecht nicht in die klassische, für Juristen gewohnte Dichotomie von Öffentlichem Recht und Privatrecht einordnen lässt. Stattdessen greifen öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Rechtsvorschriften aus mehreren Teilbereichen ineinander. Während die Regulierung und deren Kontrolle eine hoheitliche Tätigkeit ist, die dem Öffentlichen Recht unterfallen, sind die jeweiligen Vertragsbeziehungen dem Zivilrecht zuzuordnen, wobei nicht nur das Vertragsrecht, sondern auch das Kartellrecht eine zentrale Rolle spielt. Zudem muss ein Anwalt für Energierecht bei kommunaler wirtschaftlicher Betätigung die kommunalwirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen beachten (Kommunalrecht). Das sind unter anderem die Grenzen der Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung durch Kommunen (z.B. § 107a GO NRW) oder der Anschluss- und Benutzungszwang bei Fernwärme (§ 9 GO NRW).
So hat die Kanzlei KOENEN BAUANWÄLTE als Anwalt für Energierecht die europarechtlichen Rahmenbedingungen (Verordnungen und Richtlinien) ebenso wie die Gesetze und Verordnungen auf nationaler Ebene im Blick zu behalten. Des Weiteren muss im Energierecht berücksichtigt werden, dass diese Normen einem stetigen Wandel unterliegen, wobei das Klimaschutzgesetz (KSG) und das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) einer besonderen Erwähnung bedürfen.
Die Wechselwirkung von Öffentlichem und Privatem Recht wird noch durch das (nationale) Vergaberecht überlagert, das im Hinblick auf die Erteilung von Aufträgen an Dienstleister, Lieferanten und Bauunternehmer zu beachten ist.